Forst und Jagd
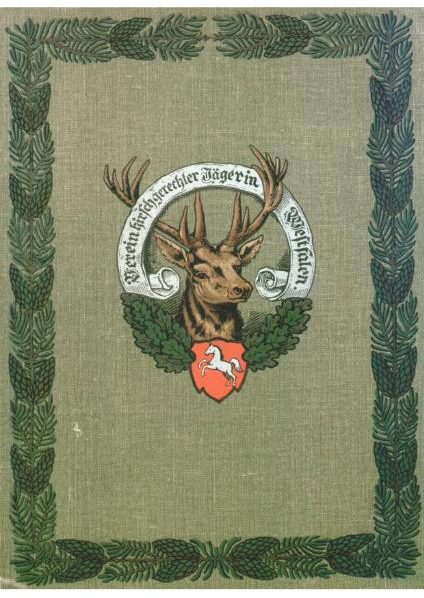
Foto: Karl Féaux de Lacroix, Public domain, via Wikimedia Commons
Wölfe, Oberjägermeister und die Försterfamilie Holzapfel
Völlinghausen, im Jahre 1840
Mein Name ist Goddefridus Matthias Holzapfel, Förster zu Völlinghausen. So stelle ich mich noch immer vor, auch wenn meine Schritte kürzer geworden sind und der Hirschfänger nur noch zur Zierde über dem Kamin hängt. Der Wald hat mir ein langes Leben geschenkt, voller Arbeit, Pflicht – und Frieden. Ich bin Förster und Forstinspektor gewesen, großherzoglicher Oberförster sogar. Aber vor allem war ich: Sohn, Enkel und Urenkel von Männern des Waldes.
Ich erinnere mich an die Stimme meines Vaters, wie sie durch die Dämmerung klang, als er mir die alten Geschichten erzählte. Vom ersten Schritt in den Forst, vom ersten Schuss, von der ersten Pirsch – und von der Verantwortung, die auf uns lag. Er hieß Franziskus Antonius, und er trug das Amt in Völlinghausen wie seinen Waidmantel: mit Ernst und Würde. Er war kein lauter Mann, aber jeder im Dorf wusste, dass sein Wort Gültigkeit hatte. Denn nicht selten wurde es am Rande des Waldes auch mal laut. Dann nämlich, wenn an das Holz und das Land Ansprüche gestellt wurden.
Als er für immer ging – ich war gerade 17 Jahre alt - war es lange still im Haus. Obwohl er das Ende gefunden hatte, das er sich gewünscht hatte. Nicht alt und siechend in einem Bett, fand man ihn, sondern am Fuß einer alten Eiche. Der Wald hatte ihn heimgerufen.
Doch mein Vater war nicht der erste Waldmann in unserer Familie. Sein Vater, mein Großvater Gaudentius, hatte schon vor ihm das Gewehr getragen – als kurfürstlicher Jäger in Freienohl. In den alten Büchern steht sein Name noch heute, verbunden mit dem Amt, das unser Geschlecht über Generationen begleitete. Sein Pate war kein Geringerer als der Oberjägermeister Gaudentius von Weichs.
Sein Vater wiederum, mein Urgroßvater Philipp, stammte aus Hirschberg. Dort war sein Vater Caspar ebenfalls schon Jäger. Philipp heiratete eine Hoferbin aus Freienohl und blieb deshalb in dem Ort. Er war dort nicht nur der Forstmann, sondern wurde sogar zweimal zum Bürgermeister gewählt. Als Förster und Jäger konnte er natürlich auch mit dem Gewehr umgehen, kein Wunder, dass er auch zum ersten Richtmann der Schützenbruderschaft wurde.
In Freienohl steht noch immer – allerdings an einem anderen Platz – eine Kapelle, die er mit seiner ersten Frau gestiftet hatte. Ein Jahr nach ihrem Tod heiratete er erneut, meine Urgroßmutter. Das Leben meines Urgroßvaters Philipp endete genau so, wie es sich ein Forstmann wünscht. Frühmorgens ritt er aus in Richtung Wallen. Dort, „ungefähr zu Frühstückszeit“, wie es im Kirchenbuch lateinisch heißt, hauchte er sein Leben aus.
Die Ämter, die wir Holzapfels trugen, waren erblich. Die Schriften über die Forststellen in Neuhaus, Delecke und Körbecke sprechen davon: „Amtserblichkeit“. Ein stolzes Wort für ein stilles Gesetz. Der Sohn trat ein, wenn der Vater fiel – und wenn er würdig war, so blieb das Amt in der Hand der Familie.
Als Jägerkind wurde ich früh an die Leithunde herangeführt. Drei Jahre dauerte meine Lehrzeit, die man „Behang“ nannte. Ich lernte, ihre Zeichen zu deuten, sie zu führen, zu halten, zu achten. Erst nach diesen Jahren wurde ich zum „Jägerburschen“ erhoben – ein stolzer Moment. Ich durfte endlich den Hirschfänger tragen und war nun ein „wehrhafter“ Mann.
Die Wolfsjagd
Große Wolfsjagden habe ich kaum mehr erlebt. Sie gehörten bereits der Vergangenheit an. Aber mein Großvater sprach oft mit glänzenden Augen davon, wie man einst hunderte Männer aufbot, um dem Wolf Einhalt zu gebieten. Der ganze Forst bebte von Hörnern, Rufen und dem Hall der Flinten.
Die Jäger hatten einen festen Ledergürtel über den kurzen Rock des grünen Anzugs geschnallt, in der Hirschfänger, ein Schwamm für die Fährtensuche und der Feuerstein staken. Die Hosen waren aus festen Stoffen gefertigt und durch Gamaschen geschützt. Der Jäger trug ein Jagdhorn; als Waffe war ihm neben dem Hirschfänger wohl schon früh das Gewehr zugebilligt.
Es ging los, wenn frischer Schnee gefallen war. Unsere Feuerstätte, also dort, wo sich Jäger und Spürer trafen, lag in Neuhaus. Andere gab es auch in Enste und Visbeck. Die Männer kamen mit Trommeln, Schwertern, Spießen, Fangeisen. Und mit gewobenen Fangtüchern, die aus Arnsberg stammten.
Wurde Canis lupus erspäht, so schloss sich der Kreis: Die Trommeln dröhnten, die Treiber trieben, Fangeisen blitzten zwischen Baumstämmen, Gewehre wurden erhoben. Oft war es der Oberjägermeister, der den Balg des Tieres als Trophäe erhielt – ein sichtbarer Lohn für eine gefährliche Tat, die selten ohne Risiko war.
Für diese Männer war die Jagd nicht nur Notwendigkeit – sie war ein Ritual. Und für die oberen Schichten auch ein gesellschaftliches Ereignis. Nach erfolgreicher Jagd wurde der Balg des Wolfes dem Oberjägermeister übergeben, und es folgte ein feuchtfröhliches Zechgelage, dessen Kosten oft von der Landeskasse getragen wurden.
Mit der Zeit änderte sich jedoch die Einstellung zur Wolfsjagd. Nach dem Dreißigjährigen Krieg war das Volk müde und ausgezehrt, und die Begeisterung für die Jagd ließ nach. Der letzte Wolf in Westfalen wurde 1835 geschossen.
Heute denke ich oft an unsere Familienline, die sich durch uns zieht wie ein alter Pirschpfad durch den Forst: Caspar, Philipp, Gaudentius, Franziskus und ich. Leider endet der Pfad mit mir, denn meine Söhne arbeiten lieber als Verwalter als im Wald. Die Mädels können sich zwar für den Wald begeistern und sind oft mit mir gelaufen - bis sie dann geheiratet haben.
Fakten
1835 wurde der letzte Wolf in Westfalen (Wittgenstein-Berleburg nicht eingerechnet) erlegt, der später ins zoologische Museum zu Münster gebracht wurde.
- Goddefridus Matthias Holzapfel (1765–1844)
Großherzoglicher Oberförster, später Förster/Forstinspektor in Völlinghausen
Verheiratet 1806 in Bremen mit Maria Anna Aloysia Seaphina Hake - Vater: Franziskus Antonius Holzapfel (1729–1794)
Geboren in Neuhaus, Förster in Völlinghausen
Verheiratet mit Sophia Anna Maria Agnes Wert aus Hirschberg
Die Familie wohnte im kurfürstlichen Jägerhaus In Neuhaus
- Großvater: Gaudentius Holzapfel (1696–1764)
Kurfürstlicher Jäger in Freienohl
Gestorben in Neuhaus-Körbecke
Taufpate: Gaudentius von Weichs, herzogl. westfäl. Oberjägermeister
Genannt in den Schriften zur Amtserblichkeit an den Forststellen Delecke, Neuhaus, Körbecke - Urgroßvater: Philipp Holzapfel (1666-1737)
Geboren in Hirschberg, Sohn des Caspar Holzapfel (ebenfalls Jäger)
Kurfürstlicher Jäger, Konsul, Bürgermeister von Freienohl
Stifter der Rümmecken-Kapelle
Verstarb im Forst bei Wallen während eines Jagdausritts - Urur-Großvater Caspar Holzapfel (1630-1690
Die Kinder von Goddefredus waren: Gottfried, Sophie, Clemens Wilhelm, Therese, Franziskus Josephus Aloisus. Näheres über sie ist -noch - nicht bekannt.
Quellen:
Universitäts- und Landesbibliothek Münster „Geschichte der hohen Jagd im Sauerlande“ Autor: Féaux de Lacroi https://sammlungen.ulb.uni-muenster.de/hd/content/titleinfo/53813
matricula online, ancestry.de
freienohler.de
Text: Christel Zidi

Das Forsthaus im Jahre 1899
Foto: Grobbel-Mitarbeiter; namentlich nicht zu ermitteln, Public domain, via Wikimedia Commons

Das Forsthaus heute
Foto: Altes Forsthaus, CC BY-SA 3.0 via Wikimedia Commons
Die Försterfamilie Schnettler im Forsthaus Rehsiepen
Rehsiepen, im Jahre 1895
Ein frischer Herbstmorgen war’s, als meine liebe Frau Maria und ich das neue Forsthaus zu Rehsiepen bezogen. Noch standen die Möbel ungeordnet, der Stall war leer – und doch hätte das Haus für uns kaum vollendeter sein können. Ich war der zweite Förster, der hier seinen Dienst antrat, nachdem mein Vorgänger den Bau mit Bedacht und Sachverstand geplant und begleitet, aber schon nach wenigen Jahren wieder verlassen hatte.
Was Förster Schmitt mit Sinn für Dauerhaftigkeit und Zweckmäßigkeit erschaffen hatte, durften wir übernehmen: Der Tennenboden war mit Bachsteinen im Fischgrätmuster gelegt, im Gewölbekeller stand ein gemauerter Backofen, in dem Maria schon bald das erste Brot buk. Auf dem Dachboden richteten wir eine Räucherkammer ein – noch im ersten Winter hingen dort Würste und Speck, durchzogen vom Duft des Wacholders.
Das Treppenhaus mit seinen gedrehten Wangen zeugte von kunstvollem Tischlerhandwerk, ebenso wie die kräftigen Türen, die sauber gefassten Fenster und die gediegenen Beschläge.
Wir liebten all die durchdachten Kleinigkeiten: das kleine Flurfenster, das der Speisekammer Frischluft spendete, und die feinen Schublädchen unter den Fensterbänken, in denen sich das Tauwasser der kalten Scheiben sammelte. Und wir liebten es, an Winterabenden vor dem warmen Ofen zu sitzen, während draußen das Rehsiepener Land tief verschneit lag.
Zwischen 1890 und 1894 schenkte uns der Herr vier Söhne. Der Erstgeborene erhielt meinen Namen: Christian Joseph. Der zweite heißt Christian Benedikt, der dritte Friedrich, und unser vierter Sohn wurde – zu Ehren des heiligen Hubertus, des Schutzpatrons aller Jäger und Forstleute – auf den Namen Hubertus getauft. Alle vier haben den Segen in St. Gertrudis in Oberkirchen bekommen, in dieser wunderschönen alten Kirche. Wenn – so Gott will – wir noch ein Mädel bekommen, dann werden wir es Gertrud nennen.
Rehsiepen ist noch ein junger Ort – kaum fünf Häuser zählt man, vielleicht fünfzig Seelen, ein paar Kühe, ein Schwein. Seit sich die ersten Köhler vor gut siebzig Jahren hier angesiedelt hatten, war Leben eingekehrt. Wir pflegten keinen regelmäßigen, aber einen guten Kontakt zu den Menschen im Ort, besonders zu den Familien Schütte und Siepe.
Fast täglich zog ich zu Fuß ins 2.200 Morgen große Revier – bei Wind und Wetter. Eines Tages würden mich meine Söhne begleiten, doch noch waren ihre Beine zu kurz und die Wege zu weit.
Maria kümmerte sich derweil um Haus und Garten. Sie versorgte Kinder und Vieh, buk Brot, machte Wurst, strich Bohnerwachs auf die Dielen. Mit den Jahren wurde das Forsthaus weit mehr als eine Amtswohnung – es wurde Heimat. Auch für Maria, die sich anfangs vor den dunklen, dichten Fichtenwäldern gefürchtet hatte.
Heute stehe ich ein letztes Mal vor dem Küchenfenster und blicke hinaus. Es ist wieder Herbst – doch ein Herbst des Abschieds. In Rehsiepen habe ich nicht nur den Wald gepflegt, sondern auch Wurzeln geschlagen. Doch das Königliche Forstamt Glindfeld sieht anderes für mich vor, und wir müssen noch einmal neu beginnen. Hoffentlich für länger.
Das Revier – und auch das Haus – geben wir in andere Hände. Ein junger Mann aus dem Ort, Fritz Schneidermann, wird meine Stelle übernehmen. Ich kenne ihn – und ich weiß, er wird es gut machen.
Historischer Hintergrund
- Um 1600: Erste Erwähnung der Flurbezeichnung „im Rhesypen“ in der Oberkirchener Statistik
- 1824: Zwei Köhlerfamilien siedeln sich an
- 1884/1885: Bau des Rehsiepener Forsthauses
- 1885–1887: Amtszeit des Revierförsters Schlegel
- 1887–1895: Amtszeit des Revierförsters Christian Schnettler
- 1890–1894: Geburt der vier Söhne des Försters
- 1895–1898: Amtszeit des Försters Fritz Schneidermann
- Insgesamt 13 Förster bewohnten das Forsthaus in 85 Jahren
- Bis 1971: Kauf des Hauses durch Peter und Bärbel Michel, die es liebevoll renovierten
Quellen: „Forsthaus Rehsiepen – Ein Haus wird 100 Jahre alt“ von Peter und Bärbel Michels
www.ancestry.de
Text: Christel Zidi